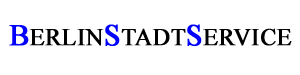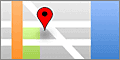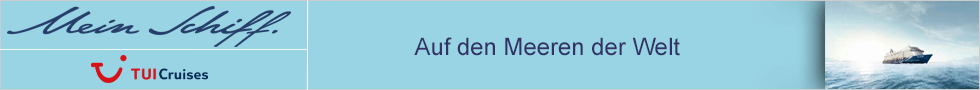Schloss Berlin - Kulturerbe
Schloss der Hohenzollern auf der Museumsinsel - Preußenschloss - Museum - Sehenswürdigkeit
Das Schloss Berlin der Hohenzollern wurde 1442 auf der Spreeinsel in Alt-Cölln erbaut. Das Schloss wurde nach seinen barocken Erweiterungen 1702 zur königlich-preußischen Residenz und Hofsitz des Deutschen Kaiserreich. Das Schloss befindet sich auf der Museumsinsel im Bezirk Mitte und ist heute eine viel besuchte Sehenswürdigkeit.

Schloss Berlin erbaut von der Familie Hohenzollern
Erbaut wurde das Schloss Berlin von der Familie Hohenzollern, die später die Könige von Preußen und den Deutschen Kaiser stellten.
Nach dem Untergang des Kaiserreichs beherbergte das Gebäude das Schlossmuseum (auch genannt Kunstgewerbemuseum Berlin). Im Schlüterhof fanden Konzerte statt.
Das historische Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt und 1950 auf Beschluss der SED (DDR-Regierung) gesprengt.
Im Jahr 2020 sind das Barockschloss und der Schlüterhof unter Verwendung rekonstruierter Fassaden- und Gebäudeteile originalgetreu wiederaufgebaut.

Sehenswürdigkeit und Kulturerbe
Das Residenzschloss ist nicht nur ein Kulturerbe sondern auch das zentrale Bauwerk in der Mitte Berlins und zugleich Endpunkt der Prachtstraße "Unter den Linden" und eine der am meisten frequentierten Sehenswürdigkeiten von Berlin .
Es gibt auch Führungen ...
Besucher Informationen Schloss Berlin
Bistro - Performance - Shop - Schlüterhof - Museum - Ausstellung - Führung - Events
| Öffnungszeiten | |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 22:00 |
| Dienstag | 10:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 22:00 |
| Freitag | 10:00 - 22:00 |
| Samstag | 10:00 - 22:00 |
| Sonntag | 10:00 - 22:00 |
| Eintrittspreise | |
| Normal | - |
| Ermäßigt | - |
Auf den Spuren des Kaiserhauses Hohenzollern
Interessante Orte in Berlin
Das Schloss Berlin der Hohenzollern wurde 1442 auf der Spreeinsel in Alt-Cölln erbaut. Zu erst entstand die Burg „Zwing Cölln“ in der damaligen Stadt Cölln direkt an der Langen Brücke über die Spree, am Übergang zu dem damals noch unbedeutenden märkischen Städtchen Berlin, das mit Cölln eine Doppelstadt bildete. Die westlichen Stadterweitererungen der Kurfürsten Friedrich Wilhelms I., des Großen Kurfürsten (1640-88) und Friedrichs III., des seit 1701 gekrönten Königs Friedrich I. in Preußen (1688-1713), machten das Schloss zur Mitte der Stadt. Das Schloss wurde nach seinen barocken Erweiterungen 1702 zur königlich-preußischen Residenz und Hofsitz des Deutschen Kaiserreich.
Im Zuge der westlichen Stadterweiterungen der Kurfürsten Friedrich Wilhelms I., des Großen Kurfürsten (1640-88), und Friedrichs III., des seit 1701 gekrönten Königs Friedrich I. in Preußen (1688-1713), wurde das Schloss zur Mitte der Stadt.
Nach seinen barocken Erweiterungen im Jahr 1702 wurde das Schloss zur königlich-preußischen Residenz und zum Hofsitz des Deutschen Kaiserreichs.
Der Beginn mit der Burg Zwing
Gemäß der Überlieferung legte Friedrich II. von Brandenburg (1413-1471) am 31. Juli 1443 den Grundstein für den ersten Schlossbau. Die Fertigstellung der Burg erfolgte im Jahr 1451.
Das fertiggestellte Schlossbauwerk fungierte für Friedrich II., auch als Eisenzahn bezeichnet, als kurfürstliche Residenz sowie als Wehranlage, die sowohl die Funktion einer Burg als auch einer Zitadelle umfasste. Von dieser Anlage aus war es möglich, die auf der Spreeinsel verlaufenden Handelswege zu kontrollieren.
Im 16. Jahrhundert veranlasste Kurfürst Joachim II. (1505-1571) den weitgehenden Abriss der spätmittelalterlichen Anlage, um an ihrer Stelle ein Renaissancebauwerk zu errichten. In der Folge etablierte er Berlin als feste Residenz der Hohenzollern.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts veranlasste Kurfürst Johann Georg (1525-1598) den Bau des Westflügels und den Hofabschluss.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg veranlasste Kurfürst Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (1620-1688), die Wiederherrichtung des Schlosses, das zu diesem Zeitpunkt einen erheblichen Verfall aufwies. Im Zuge dessen entstanden bedeutende Innenräume wie die Kugelkammer oder die Braunschweigische Galerie.
Unter der Regentschaft von Kurfürst Friedrich III. (ab 1701: König Friedrich I. von Preußen, 1657–1713) wurde das Schloss zur Königsresidenz ausgebaut. Zu diesem Zwecke wurde der Schlossbaumeister Andreas Schlüter mit der Umsetzung beauftragt. Im Rahmen dessen wurde auch das sogenannte Bernsteinzimmer geschaffen, das mit Bernstein, Gold- und Spiegelelementen ausgestattet war und sich im nordwestlichen Eckraum des zweiten Obergeschosses (heute als Weißer Saal bekannt) befand.
Gemäß den historischen Aufzeichnungen veranlasste der Nachfolger König Friedrich Wilhelm I. (1688-1740) die Vollendung des Schlosses durch den Baumeister Martin Heinrich Böhme in einer äußerlich vereinfachten Form. In der Südostecke wurde ein kleiner Kuppelturm für das Geläut der Schlosskapelle errichtet. Das Bernsteinzimmer wurde 1716 von Friedrich Wilhelm I. an den russischen Zaren Peter den Großen verschenkt.
König Friedrich Wilhelm II. (1744-1797) richtete die als "schönste Königswohnung" bekannte Residenz im Schloss ein, die sogenannten Königskammern im Lustgartenflügel, welche im Stil des Klassizismus gestaltet wurden.
König Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) initiierte keine signifikanten baulichen Veränderungen am Schloss. Es erfolgten lediglich partiell Erneuerungen von Gesimsen, Balustraden und Fensterbedachungen, wobei die Skulpturen der Dachbalustraden entfernt wurden.
Im Jahr 1840 bezog Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) eine Zimmerflucht im ersten Obergeschoss an der Spree und dem Lustgarten. Abgesehen von der zentralen, 70 m hohen Kuppel über dem Eosanderportal wurden an der Fassade im 19. und 20. Jahrhundert nur kleinere Änderungen vorgenommen.
Im Rahmen der unter Kaiser Wilhelm I. (1797-1888) durchgeführten Baumaßnahmen wurde lediglich der Schlüterhof des Schlosses einer Veränderung unterzogen. Das Quergebäude wurde mit einer neuen Fassade versehen, die stilistische Merkmale der Neo-Renaissance aufwies.
Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) veranlasste eine Vielzahl von Baumaßnahmen am Schloss. So wurde der Abbruch des Schinkeldoms, ein Neubau einer monumentalen Kuppelkirche im historisierenden Neobarock, die Auskernung des Weißer-Saal-Flügels, der Neubau der Wilhelmschen und Mecklenburgischen Wohnung angeordnet. Darüber hinaus wurde das gesamte Gebäude elektrifiziert und mit fließendem Wasser ausgestattet.
Im November 1918 wurde Kaiser Wilhelm II. vertrieben. In der Folge wurde das Schloss von Arbeiter- und Soldatenräten besetzt und geplündert.
In das geschundene Gebäude zog das Schlossmuseum mit den bedeutendsten kunstgewerblichen Sammlungen Berlins ein. Zu den neuen Mietern zählten unter anderem die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die Vorgängerin der heutigen Max-Planck-Gesellschaft, das Phonogramm-Archiv, die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, das Psychologische Institut der Universität, die Landesanstalt für Gewässerkunde, das Museum für Leibesübungen, die Gewerkschaft deutscher Verwaltungsbeamter, die Zentrale für Kinderspeisung und für die Vermittlung für Heimarbeit, das Helene-Lange-Heim und die Studentenhilfe. In den zahlreichen Wohneinheiten wurden die Museumsdirektoren sowie eine Anzahl von Privatpersonen untergebracht.
Im Zeitraum von 1933 bis 1945 wurde das Schloss von den Nationalsozialisten für zahlreiche Veranstaltungen angemietet.
Im Mai 1944 wurde das Schloss bei einem Bombenangriff schwer beschädigt. In der Folge wurden die Große Bildergalerie, die darunter liegenden Königskammern sowie die im Erdgeschoss befindlichen Residenzen Friedrich Wilhelms I. schwer beschädigt oder gar zerstört.
Im April 1945 wurde die Schlossplatzfassade unter Artilleriebeschuss genommen. Das Gebäude war in seiner Substanz intakt und wies im Vergleich zum Charlottenburger Schloss weniger Schäden auf. Es konnte festgestellt werden, dass zahlreiche Räumlichkeiten vollständig erhalten waren. In der Folgezeit, konkret zwischen 1945 und 1950, wurden in dessen Räumlichkeiten wiederholt Ausstellungen durchgeführt.
Der Oberbürgermeister von Ostberlin, Friedrich Ebert junior, der der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) sowie der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) angehörte, setzte sich vehement gegen jegliche Bestrebungen ein, am Schloss wiederaufzubauen. So wurde das Berliner Schloss im Jahr 1950 aufgrund angeblicher Baufälligkeit gesprengt. An seiner Stelle wurde der Marx-Engels-Platz mit einer großen Tribüne errichtet, die für die Durchführung großer Demonstrationsaufmärsche genutzt wurde.
Auf dem Schlossgelände wurde 1976 der Palast der Republik errichtet und als Veranstaltungsort der DDR für politische und kulturelle Großveranstaltungen genutzt. Fünfzehn Jahre später wurde der Palast der Republik aufgrund einer hochgradigen Asbestverseuchung geschlossen und abgerissen.
Im Juli 2002 wurde seitens des Deutschen Bundestages mit überwältigender Mehrheit der Beschluss zum Wiederaufbau des Berliner Schlosses gefasst.
Seit dem Jahr 2020 bildet das Berliner Schloss mit seinen rekonstruierten Elementen das Zentrum der Hauptstadt. Der finanzielle Bedarf des Wiederaufbaus des historischen Gebäudes wurde zu einem signifikanten Anteil durch private Spenden gedeckt.
Was sie in Berlin gesehen haben müssen
Interessante Orte in Berlin